Übersicht:
- Der Fall vor Gericht
- Rückzahlung überzahlter Vergütung im Öffentlichen Dienst: Keine Prozesskostenhilfe für Berufung nach Kündigung
- Ausgangssituation: Kündigung in der Probezeit und Weiterzahlung des Gehalts
- Streitpunkt: Rückforderung der Überzahlung und angebliche Benachrichtigung durch die Ex-Mitarbeiterin
- Die Widerklage der ehemaligen Mitarbeiterin: Forderung nach einem qualifizierten Arbeitszeugnis
- Entscheidung des Arbeitsgerichts Hannover: Pflicht zur Rückzahlung und Abweisung der Widerklage
- Begründung des Arbeitsgerichts: Ungerechtfertigte Bereicherung und Bösgläubigkeit
- Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen: Keine Prozesskostenhilfe für die Berufung
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Unter welchen Voraussetzungen kann der Arbeitgeber im öffentlichen Dienst überbezahltes Gehalt zurückfordern?
- Welche Rolle spielt die Kenntnis des Arbeitnehmers über die Überzahlung bei der Rückforderung von Gehalt im öffentlichen Dienst?
- Welche Fristen gelten für die Rückforderung von zu viel gezahltem Gehalt im öffentlichen Dienst und wann beginnt die Frist zu laufen?
- Kann ich die Rückzahlung von überzahltem Gehalt im öffentlichen Dienst verweigern, wenn ich das Geld bereits ausgegeben habe?
- Welche Möglichkeiten der Ratenzahlung oder des Verzichts auf Rückforderung gibt es bei überbezahltem Gehalt im öffentlichen Dienst?
- Glossar
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Hinweise und Tipps
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 4 SLa 755/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Landesarbeitsgericht Niedersachsen
- Datum: 18.03.2025
- Aktenzeichen: 4 SLa 755/24
- Verfahrensart: Beschluss über Prozesskostenhilfe im Berufungsverfahren
- Rechtsbereiche: Arbeitsrecht, Bereicherungsrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Das klagende Land (ehemaliger Arbeitgeber), das überzahlte Vergütung zurückfordert.
- Beklagte: Eine ehemalige Arbeitnehmerin, die nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses weiter Gehalt erhielt und dieses zurückzahlen soll. Sie beantragt Prozesskostenhilfe für die Berufung und hat Widerklage wegen eines Arbeitszeugnisses erhoben.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Das Arbeitsverhältnis der Beklagten endete am 31.08.2022 durch Kündigung des Landes in der Probezeit. Trotzdem zahlte das zuständige Landesamt der Beklagten vom 01.09.2023 bis 31.12.2023 weiterhin Gehalt. Das Land forderte die Überzahlung von 13.235,99 € netto zurück. Die Beklagte erhob Widerklage auf Erteilung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses. Das Arbeitsgericht Hannover entschied am 25.09.2024 (Az. 1 Ca 32/24 Ö) über die Klage und Widerklage. Die Beklagte möchte gegen dieses Urteil Berufung einlegen und beantragt dafür Prozesskostenhilfe.
- Kern des Rechtsstreits: Im zugrundeliegenden Verfahren geht es um die Frage, ob die Beklagte zur Rückzahlung der überzahlten Vergütung verpflichtet ist und ob sie Anspruch auf ein bestimmtes Arbeitszeugnis hat. Streitig ist unter anderem, ob die Beklagte das Land über die Weiterzahlung informiert hat. In diesem Beschluss geht es darum, ob die Berufung der Beklagten gegen das erstinstanzliche Urteil Aussicht auf Erfolg hat, was Voraussetzung für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe ist.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Der Antrag der Beklagten auf Gewährung von Prozesskostenhilfe für das Berufungsverfahren gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Hannover wird zurückgewiesen. Die Rechtsbeschwerde gegen diesen Beschluss wird nicht zugelassen.
- Folgen: Die Beklagte erhält keine finanzielle Unterstützung vom Staat für die Durchführung des Berufungsverfahrens. Wenn sie Berufung einlegen möchte, muss sie die Kosten dafür selbst tragen. Der Beschluss kann nicht direkt beim Bundesarbeitsgericht angefochten werden.
Der Fall vor Gericht
Rückzahlung überzahlter Vergütung im Öffentlichen Dienst: Keine Prozesskostenhilfe für Berufung nach Kündigung
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen hat entschieden, dass einer ehemaligen Mitarbeiterin des Landes keine Prozesskostenhilfe (PKH) für ihr Berufungsverfahren gewährt wird.
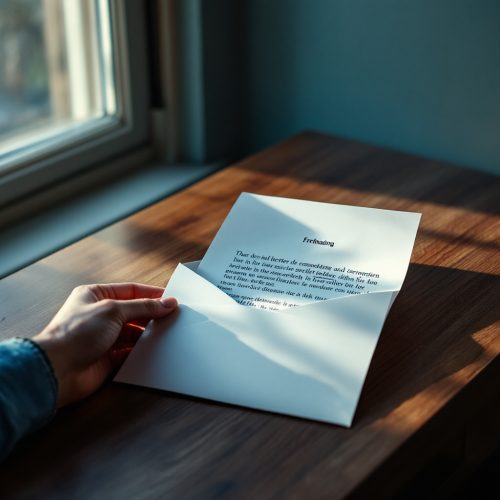
Sie wollte sich gegen ein Urteil des Arbeitsgerichts Hannover wehren, das sie zur Rückzahlung von zu viel erhaltener Vergütung in Höhe von 13.235,99 € netto verurteilt hatte. Der Arbeitgeber, das Land Niedersachsen, hatte ihr auch nach Ende des Arbeitsverhältnisses weiterhin Gehalt gezahlt. Das LAG sah keine ausreichenden Erfolgsaussichten für die Berufung der Frau.
Ausgangssituation: Kündigung in der Probezeit und Weiterzahlung des Gehalts
Die spätere Beklagte war vom 14. Februar 2022 bis zum 31. August 2022 als IT-Systems Engineer im Bereich Netzwerk und Security beim Landesamt für Steuern Niedersachsen tätig. Ihr Arbeitsverhältnis unterlag dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Der Arbeitgeber, das Land Niedersachsen, kündigte das Arbeitsverhältnis noch innerhalb der Probezeit fristgerecht zum 31. August 2022.
Trotz der Kündigung und des damit beendeten Arbeitsverhältnisses zahlte das zuständige Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Versorgung (NLBV) der Frau im Zeitraum vom 1. September 2023 bis zum 31. Dezember 2023 weiterhin ihr bisheriges tarifliches Arbeitsentgelt aus. Insgesamt erhielt sie so 13.235,99 € netto zu viel.
Streitpunkt: Rückforderung der Überzahlung und angebliche Benachrichtigung durch die Ex-Mitarbeiterin
Das Land Niedersachsen forderte die ehemalige Mitarbeiterin mit Schreiben vom 24. Januar 2023 auf, die überzahlte Summe zurückzuerstatten. Da dies außergerichtlich erfolglos blieb, reichte das Land am 9. Februar 2024 Klage beim Arbeitsgericht Hannover ein.
Ein zentraler Streitpunkt im Verfahren war die Frage, ob die ehemalige Mitarbeiterin das NLBV über die fehlerhaften Gehaltszahlungen informiert hatte. Sie behauptete, am 6. Oktober 2022 ein Schreiben vom 4. Oktober 2022 in den Briefkasten des NLBV eingeworfen zu haben. In diesem Schreiben soll sie darauf hingewiesen haben, dass sie trotz der Kündigung weiterhin monatliche Gehaltszahlungen erhalte.
Das Land Niedersachsen bestritt den Erhalt dieses Schreibens. Zudem wurde angemerkt, dass das von der Frau vorgelegte Schreiben weder ihre Personalnummer noch ein Aktenzeichen enthielt und auch nicht an einen konkreten Ansprechpartner oder Sachbearbeiter gerichtet war. Diese fehlenden Angaben hätten eine Zuordnung im Amt erheblich erschwert, selbst wenn das Schreiben angekommen wäre.
Die Widerklage der ehemaligen Mitarbeiterin: Forderung nach einem qualifizierten Arbeitszeugnis
Im Laufe des Gerichtsverfahrens erhob die ehemalige Mitarbeiterin ihrerseits eine Widerklage. Mit dieser forderte sie das Land Niedersachsen auf, ihr ein qualifiziertes Arbeitszeugnis auszustellen, das ihre Leistungen und ihr Verhalten mit der Note „gut“ bewertet.
Entscheidung des Arbeitsgerichts Hannover: Pflicht zur Rückzahlung und Abweisung der Widerklage
Das Arbeitsgericht Hannover gab mit Urteil vom 25. September 2024 der Klage des Landes Niedersachsen vollumfänglich statt. Es verurteilte die ehemalige Mitarbeiterin zur Zahlung von 13.235,99 € netto nebst Zinsen an das Land. Gleichzeitig wies das Gericht die Widerklage der Frau auf Erteilung eines guten Arbeitszeugnisses ab.
Begründung des Arbeitsgerichts: Ungerechtfertigte Bereicherung und Bösgläubigkeit
Das Arbeitsgericht stützte seine Entscheidung bezüglich der Rückzahlungspflicht auf den Grundsatz der ungerechtfertigten Bereicherung gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 Alternative 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Rechtsgrundlage § 812 BGB: Leistung ohne Rechtsgrund
Nach § 812 BGB muss derjenige, der etwas ohne rechtlichen Grund durch die Leistung eines anderen erlangt hat, dies zurückgeben. Im vorliegenden Fall hatte die ehemalige Mitarbeiterin die Gehaltszahlungen für den Zeitraum ab September 2023 (laut Urteilstext) erhalten. Da ihr Arbeitsverhältnis aber bereits am 31. August 2022 beendet war, gab es für diese Zahlungen keinen rechtlichen Grund mehr (keinen gültigen Arbeitsvertrag). Die Zahlungen erfolgten also rechtsgrundlos.
Keine Anwendung von § 814 BGB: Arbeitgeber handelte nicht in Kenntnis der Nichtschuld
Die ehemalige Mitarbeiterin konnte sich nicht auf § 814 BGB berufen. Diese Vorschrift schließt eine Rückforderung aus, wenn der Leistende (hier der Arbeitgeber bzw. das NLBV) wusste, dass er zur Leistung nicht verpflichtet war. Das Arbeitsgericht sah keine Anhaltspunkte dafür, dass das NLBV die Zahlungen in dem Wissen vornahm, dass das Arbeitsverhältnis bereits beendet war und somit kein Anspruch mehr bestand. Es handelte sich offensichtlich um ein Versehen der Behörde.
Kein Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) wegen Bösgläubigkeit
Grundsätzlich könnte sich jemand, der Geld ohne Rechtsgrund erhalten hat, darauf berufen, nicht mehr „bereichert“ zu sein, wenn er das Geld bereits ausgegeben hat (sogenannter Wegfall der Bereicherung oder Entreicherung, § 818 Abs. 3 BGB). Dieser Einwand greift jedoch nicht, wenn der Empfänger „bösgläubig“ war.
Das Arbeitsgericht stellte fest, dass die ehemalige Mitarbeiterin bösgläubig im Sinne des Gesetzes war. Das bedeutet, sie wusste oder hätte erkennen müssen, dass ihr die Gehaltszahlungen nach der Kündigung und dem Ende ihres Arbeitsverhältnisses nicht mehr zustanden.
Das Gericht argumentierte, dass sich die Frau der Einsicht verschlossen habe, dass ihr nach dem 31. August 2022 keine Vergütung mehr zustand. Als Arbeitnehmerin musste ihr klar sein, dass mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses auch der Anspruch auf Lohn entfällt. Die über Monate fortgesetzten Zahlungen hätten sie misstrauisch machen und zu einer Nachfrage veranlassen müssen. Ihr Verhalten, insbesondere das angebliche Einwerfen eines vagen Schreibens ohne konkrete Zuordnungsmerkmale, wertete das Gericht nicht als ausreichende Bemühung, den Irrtum aufzuklären. Vielmehr dränge sich der Verdacht auf, dass sie die Weiterzahlung billigend in Kauf nahm.
Da sie somit nicht im guten Glauben war, dass ihr das Geld zusteht, konnte sie sich nicht darauf berufen, das Geld bereits ausgegeben zu haben. Die verschärfte Haftung bei Bösgläubigkeit (§ 819 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 818 Abs. 4 BGB) führt dazu, dass sie zur Rückzahlung des gesamten Betrags verpflichtet ist, unabhängig davon, ob sie das Geld noch besitzt oder nicht.
Zur Abweisung der Widerklage auf Erteilung eines guten Zeugnisses enthielt der hier zusammengefasste Beschluss des LAG keine detaillierte Begründung des Arbeitsgerichts.
Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen: Keine Prozesskostenhilfe für die Berufung
Gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Hannover wollte die ehemalige Mitarbeiterin Berufung beim Landesarbeitsgericht Niedersachsen einlegen. Da sie die Kosten für das Berufungsverfahren nicht selbst tragen konnte, beantragte sie Prozesskostenhilfe (PKH).
Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen wies den Antrag auf Prozesskostenhilfe mit Beschluss vom 18. März 2025 zurück (Az.: 4 SLa 755/24).
Die Gewährung von Prozesskostenhilfe setzt voraus, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung (hier die Berufung) hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. Das LAG prüfte die Argumente der ehemaligen Mitarbeiterin und kam zu dem Schluss, dass die Berufung voraussichtlich keinen Erfolg haben würde. Die Entscheidung des Arbeitsgerichts Hannover erschien dem LAG als rechtlich fundiert und überzeugend, insbesondere hinsichtlich der Rückzahlungspflicht aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung und der festgestellten Bösgläubigkeit der ehemaligen Mitarbeiterin.
Da die Erfolgsaussichten als gering eingestuft wurden, waren die Voraussetzungen für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe nicht erfüllt. Der Beschluss des LAG bedeutet nicht das endgültige Urteil in der Berufungsinstanz selbst, aber er verwehrt der Frau die finanzielle Unterstützung für die Weiterführung des Rechtsstreits in der zweiten Instanz. Eine Rechtsbeschwerde gegen diesen PKH-Beschluss wurde nicht zugelassen.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil verdeutlicht, dass Arbeitnehmer überzahlte Gehälter nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückzahlen müssen, auch wenn sie den Arbeitgeber über die Überzahlung informiert haben. Die bloße Information an den Arbeitgeber ohne konkrete Adressierung und ohne Personalnummer reicht nicht aus, um sich von der Rückzahlungspflicht zu befreien. Entscheidend ist, dass der Empfänger überzahlter Beträge nicht darauf vertrauen darf, diese behalten zu können, nur weil der Arbeitgeber auf eine Mitteilung nicht reagiert. Die Entscheidung zeigt zudem die Wichtigkeit fristgerechter Geltendmachung von Ansprüchen wie Arbeitszeugnissen, da diese sonst verfallen können.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Unter welchen Voraussetzungen kann der Arbeitgeber im öffentlichen Dienst überbezahltes Gehalt zurückfordern?
Ein Arbeitgeber im öffentlichen Dienst kann unter bestimmten Voraussetzungen zu viel gezahltes Gehalt zurückfordern. Dies basiert grundsätzlich auf dem Rechtsprinzip der ungerechtfertigten Bereicherung (geregelt in § 812 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Einfach gesagt: Wer Geld ohne einen rechtlichen Grund erhalten hat, muss es im Normalfall zurückgeben.
Der Grundsatz: Rückzahlungspflicht bei Zahlung ohne Rechtsgrund
Wenn Sie als Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst eine Zahlung erhalten, auf die Sie rechtlich keinen Anspruch hatten (z.B. durch einen Berechnungsfehler, eine falsche Eingruppierung, die später korrigiert wird, oder eine versehentliche Doppelzahlung), liegt eine Überzahlung vor. Der Arbeitgeber hat dann grundsätzlich das Recht, diesen zu viel gezahlten Betrag zurückzufordern. Er muss beweisen, dass die Zahlung ohne Rechtsgrund erfolgt ist und wie hoch der überzahlte Betrag ist.
Ihre mögliche Verteidigung: Wegfall der Bereicherung („Entreicherung“)
Sie sind jedoch nicht immer zur Rückzahlung verpflichtet. Eine wichtige Ausnahme ist der sogenannte Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB). Das bedeutet: Wenn Sie das zu viel gezahlte Geld bereits ausgegeben haben und dabei gutgläubig waren, müssen Sie es unter Umständen nicht oder nicht vollständig zurückzahlen.
- Gutgläubigkeit: Sie waren gutgläubig, wenn Sie nicht wussten und auch nicht erkennen mussten, dass die Zahlung zu hoch war. Sie haben also darauf vertraut, dass Ihnen das Geld zusteht.
- Geld ausgegeben: Entscheidend ist, dass Sie das Geld für Dinge ausgegeben haben, die Sie sich sonst nicht geleistet hätten (z.B. eine Urlaubsreise, teurere Anschaffungen). Ausgaben für den normalen Lebensunterhalt (Miete, Lebensmittel etc.) zählen hier in der Regel nicht, da diese Kosten ohnehin angefallen wären. Sie müssen also durch die Ausgabe nicht mehr „bereichert“, also reicher, sein.
Wann entfällt die Gutgläubigkeit? Sie können sich in der Regel nicht auf den Wegfall der Bereicherung berufen, wenn:
- Sie die Überzahlung kannten: Sie wussten, dass das Geld Ihnen nicht zusteht.
- Die Überzahlung offensichtlich war: Der Fehler war so klar erkennbar (z.B. eine plötzliche Verdopplung des Gehalts ohne Grund), dass Sie ihn bei normaler Aufmerksamkeit hätten bemerken müssen (grob fahrlässige Unkenntnis). In diesem Fall geht der Gesetzgeber davon aus, dass Sie nicht schutzwürdig sind.
- Der Rückforderungsanspruch bereits rechtshängig war: Der Arbeitgeber hatte bereits Klage auf Rückzahlung erhoben, als Sie das Geld ausgegeben haben.
Wenn einer dieser Punkte zutrifft, haften Sie „verschärft“, das heißt, Sie müssen das Geld auch dann zurückzahlen, wenn Sie es nicht mehr besitzen.
Die Rolle der Beweislast
Die Verteilung der Beweislast ist hierbei klar geregelt:
- Der Arbeitgeber muss beweisen, dass eine Überzahlung stattgefunden hat und in welcher Höhe.
- Wenn Sie sich darauf berufen möchten, dass Sie das Geld nicht mehr haben und gutgläubig waren (Wegfall der Bereicherung), müssen Sie das beweisen. Sie müssen also darlegen und beweisen, dass Sie das Geld ausgegeben haben und warum Sie davon ausgehen durften, dass es Ihnen zustand.
Wichtig im öffentlichen Dienst: Tarifliche Ausschlussfristen
Eine Besonderheit im öffentlichen Dienst sind die tarifvertraglichen Ausschlussfristen (z.B. nach TVöD oder TV-L). Diese Fristen sind oft sehr kurz (häufig sechs Monate). Der Arbeitgeber muss seinen Rückforderungsanspruch innerhalb dieser Frist schriftlich geltend machen, nachdem er von der Überzahlung Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen. Versäumt der Arbeitgeber diese Frist, kann der Rückzahlungsanspruch verfallen sein, selbst wenn die oben genannten Voraussetzungen für eine Rückforderung eigentlich vorliegen würden. Diese Fristen sind daher in der Praxis von großer Bedeutung.
Welche Rolle spielt die Kenntnis des Arbeitnehmers über die Überzahlung bei der Rückforderung von Gehalt im öffentlichen Dienst?
Ihre Kenntnis über eine Gehaltsüberzahlung spielt eine entscheidende Rolle bei der Frage, ob Ihr Arbeitgeber im öffentlichen Dienst das zu viel gezahlte Geld zurückfordern kann. Grundsätzlich gilt im deutschen Recht, dass man etwas, das man ohne rechtlichen Grund erhalten hat, zurückgeben muss. Eine wichtige Ausnahme besteht jedoch, wenn man das Erhaltene bereits gutgläubig ausgegeben hat und dadurch nicht mehr „bereichert“ ist (§ 818 Abs. 3 BGB). Im öffentlichen Dienst wird diese Ausnahme aber oft durch spezielle Regelungen (z.B. in Tarifverträgen wie dem TVöD oder TV-L, oder im Beamtenrecht) stark eingeschränkt, insbesondere wenn Sie von der Überzahlung wussten oder hätten wissen müssen.
Was bedeutet „Kenntnis“?
Kenntnis bedeutet im juristischen Sinne, dass Sie positiv wussten, dass die Ihnen gezahlte Vergütung zu hoch war und Ihnen nicht zustand. Es reicht nicht aus, dass Sie vielleicht Zweifel hatten; Sie müssen sich der Fehlerhaftigkeit der Zahlung bewusst gewesen sein.
- Beispiel: Sie erhalten plötzlich über mehrere Monate hinweg Zulagen, von denen Sie durch eine vorherige Mitteilung wissen, dass sie Ihnen nicht (mehr) zustehen. Oder Ihr Gehalt verdoppelt sich ohne nachvollziehbaren Grund wie eine Beförderung oder Tariferhöhung. In solchen Fällen wird oft von Kenntnis ausgegangen.
Der Arbeitgeber muss Umstände darlegen und gegebenenfalls beweisen, aus denen sich ergibt, dass Sie die Überzahlung kannten.
Was bedeutet „grob fahrlässige Unkenntnis“?
Grob fahrlässige Unkenntnis liegt vor, wenn Sie die Überzahlung zwar nicht positiv kannten, sie Ihnen aber hätte auffallen müssen, weil die Anzeichen dafür ganz offensichtlich waren und Sie einfachste, naheliegende Überlegungen nicht angestellt haben. Es geht darum, dass Sie die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt haben. Man hätte von Ihnen erwarten können, den Fehler zu erkennen.
- Maßstab: Was hätte einer Person in Ihrer Situation bei normaler Aufmerksamkeit und unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten unbedingt einleuchten müssen?
- Beispiele:
- Eine erhebliche, unerklärliche Steigerung Ihres Nettogehalts über einen längeren Zeitraum.
- Auf Ihrer Gehaltsabrechnung ist über Monate hinweg eine offensichtlich falsche (z.B. viel zu hohe) Entgeltgruppe oder Erfahrungsstufe ausgewiesen, die nicht Ihrer tatsächlichen Einstufung entspricht.
- Sie erhalten weiterhin eine Zulage, obwohl Ihnen schriftlich mitgeteilt wurde, dass die Voraussetzungen dafür weggefallen sind.
Auch hier muss der Arbeitgeber die Umstände aufzeigen, die eine grob fahrlässige Unkenntnis begründen. Dazu gehört oft die Prüfung, ob die Gehaltsabrechnung verständlich war und wie deutlich der Fehler daraus hervorging. Sie als Arbeitnehmer haben eine gewisse Pflicht, Ihre Gehaltsabrechnungen zu prüfen.
Unterschied zwischen Kenntnis/grober Fahrlässigkeit und bloßem Verdacht
Ein bloßer Verdacht oder ein vages Gefühl, dass etwas nicht stimmen könnte (z.B. „Mein Gehalt kommt mir diesen Monat etwas hoch vor, aber ich kann es mir nicht erklären“), reicht in der Regel nicht aus, um Kenntnis oder grobe Fahrlässigkeit anzunehmen. Es müssen konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die den Fehler offensichtlich machen oder aufdrängen. Die Grenze kann im Einzelfall schwierig zu ziehen sein.
Folgen für die Rückforderung
- Bei Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis: Wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass Sie die Überzahlung kannten oder grob fahrlässig nicht kannten, können Sie sich in der Regel nicht darauf berufen, das Geld bereits ausgegeben zu haben (juristisch: „Wegfall der Bereicherung“). Die speziellen Regelungen im öffentlichen Dienst schließen diesen Einwand dann meist aus. Das bedeutet für Sie: Sie müssen das zu viel gezahlte Gehalt wahrscheinlich zurückzahlen.
- Ohne Kenntnis und ohne grobe Fahrlässigkeit: Wenn Ihnen weder Kenntnis noch grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, könnten Sie sich theoretisch darauf berufen, nicht mehr bereichert zu sein, wenn Sie das Geld bereits gutgläubig für Ihren Lebensunterhalt ausgegeben haben. Allerdings sind die Hürden hierfür im öffentlichen Dienst aufgrund der genannten Sonderregelungen oft hoch, und es kommt stark auf die genauen Umstände und die anzuwendenden Vorschriften an.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Ihre Kenntnis oder das Fehlen derselben ist der Dreh- und Angelpunkt bei der Rückforderung von überzahlter Vergütung im öffentlichen Dienst. Ob diese vorliegt, wird anhand objektiver Kriterien und der Umstände des Einzelfalls beurteilt.
Welche Fristen gelten für die Rückforderung von zu viel gezahltem Gehalt im öffentlichen Dienst und wann beginnt die Frist zu laufen?
Für die Rückforderung von zu viel gezahltem Gehalt durch den Arbeitgeber im öffentlichen Dienst gilt grundsätzlich die regelmäßige gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren. Diese Frist ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in § 195 festgelegt.
Fristbeginn: Wann startet die Uhr?
Die dreijährige Verjährungsfrist beginnt nicht automatisch mit der Überzahlung. Sie startet erst am Ende des Jahres, in dem zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind (§ 199 Abs. 1 BGB):
- Der Arbeitgeber hat Kenntnis von den Umständen, die den Rückforderungsanspruch begründen (also von der Überzahlung und warum sie erfolgte).
- Der Arbeitgeber kennt die Person des Arbeitnehmers, von dem er das Geld zurückfordern kann (was im Arbeitsverhältnis meist der Fall ist).
Alternative: Falls der Arbeitgeber keine tatsächliche Kenntnis hat, beginnt die Frist auch am Ende des Jahres, in dem er ohne grobe Fahrlässigkeit hätte Kenntnis erlangen müssen. Grobe Fahrlässigkeit bedeutet, dass der Arbeitgeber die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße missachtet hat.
Beispiel: Wurde im Jahr 2023 zu viel Gehalt gezahlt und bemerkt der Arbeitgeber dies erst im Februar 2024, beginnt die dreijährige Verjährungsfrist am 31. Dezember 2024 zu laufen und endet am 31. Dezember 2027. Hätte der Arbeitgeber die Überzahlung bereits 2023 bei sorgfältiger Prüfung bemerken müssen (grob fahrlässige Unkenntnis), würde die Frist ebenfalls am 31. Dezember 2023 beginnen und am 31. Dezember 2026 enden.
Sonderfall: Tarifliche Ausschlussfristen
Sehr wichtig im öffentlichen Dienst sind jedoch oft die tariflichen Ausschlussfristen, wie sie zum Beispiel im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder den Tarifverträgen der Länder (TV-L) in § 37 festgelegt sind.
- Diese Fristen sind deutlich kürzer als die gesetzliche Verjährungsfrist, oft betragen sie nur sechs Monate.
- Der Arbeitgeber muss seinen Rückforderungsanspruch innerhalb dieser kurzen Frist schriftlich beim Arbeitnehmer geltend machen. Die Frist beginnt hier in der Regel ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit des Anspruchs, was oft mit der Kenntnis des Arbeitgebers von der Überzahlung zusammenfällt.
- Werden diese tariflichen Ausschlussfristen vom Arbeitgeber versäumt, kann der Rückforderungsanspruch erloschen sein, auch wenn die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren noch gar nicht abgelaufen ist.
Daher sind die Regelungen im konkret anwendbaren Tarifvertrag für die Rückforderung von Gehalt oft entscheidender als die allgemeine gesetzliche Verjährung.
Hemmung und Neubeginn der Verjährung
Die Verjährungsfrist kann unter bestimmten Umständen beeinflusst werden:
- Hemmung: Die Verjährung wird quasi „angehalten“ und läuft für eine gewisse Zeit nicht weiter. Dies kann zum Beispiel passieren, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer über den Anspruch verhandeln (§ 203 BGB). Nach Ende der Hemmung läuft die restliche Frist weiter.
- Neubeginn: Die Verjährungsfrist beginnt komplett von vorne zu laufen. Dies geschieht zum Beispiel, wenn der Arbeitnehmer den Anspruch des Arbeitgebers anerkennt (z.B. durch eine Ratenzahlungsvereinbarung) oder wenn der Arbeitgeber gerichtliche Schritte einleitet (§ 212 BGB).
Die genauen Fristen und deren Beginn können von den Umständen des Einzelfalls abhängen, insbesondere von der Kenntnis des Arbeitgebers und den Regelungen des anwendbaren Tarifvertrags.
Kann ich die Rückzahlung von überzahltem Gehalt im öffentlichen Dienst verweigern, wenn ich das Geld bereits ausgegeben habe?
Grundsätzlich gilt: Wenn Ihr Arbeitgeber im öffentlichen Dienst Ihnen zu viel Gehalt gezahlt hat, darf er das überzahlte Geld zurückfordern. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz, dass niemand ohne rechtlichen Grund Geld behalten darf, das ihm nicht zusteht (§ 812 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).
Ob Sie die Rückzahlung verweigern können, weil Sie das Geld bereits ausgegeben haben, hängt entscheidend vom sogenannten Einwand der Entreicherung ab (§ 818 Abs. 3 BGB). Das bedeutet, Sie könnten unter bestimmten Umständen von der Rückzahlung befreit sein, wenn das Geld nicht mehr in Ihrem Vermögen vorhanden ist.
Was bedeutet Entreicherung?
Entreicherung liegt vor, wenn die Bereicherung weggefallen ist. Das heißt, das zu viel erhaltene Geld ist nicht mehr bei Ihnen vorhanden – weder als Bargeld, noch auf dem Konto, noch in Form von Vermögensgegenständen, die Sie damit gekauft haben.
Wichtig ist dabei: Nicht jede Ausgabe führt zur Entreicherung im rechtlichen Sinne.
- Keine Entreicherung liegt vor, wenn Sie das Geld für Dinge ausgegeben haben, die Sie sich ohnehin hätten leisten müssen oder wollen (sogenannte Ersparnis von Aufwendungen). Beispiele hierfür sind die Bezahlung Ihrer Miete, der Kauf von Lebensmitteln oder die Tilgung eines Kredits. In diesen Fällen haben Sie durch die Überzahlung eigene Ausgaben gespart, die Sie sonst aus Ihrem regulären Vermögen hätten tätigen müssen. Ihr Vermögen ist also trotz der Ausgabe nicht wirklich „geschmälert“.
- Eine Entreicherung kann vorliegen, wenn Sie das Geld für Luxusausgaben verwendet haben, die Sie sich ohne die Überzahlung niemals geleistet hätten und die Ihnen keinen bleibenden Vermögenswert verschafft haben. Beispiele könnten eine teure Urlaubsreise sein, die Sie sonst nicht unternommen hätten, oder der Kauf von Luxusgütern ohne bleibenden Wert.
Voraussetzung: Gutgläubigkeit
Eine entscheidende Voraussetzung, um sich auf Entreicherung berufen zu können, ist Ihre Gutgläubigkeit. Das bedeutet:
- Sie wussten nicht, dass die Zahlung zu hoch war.
- Sie haben die Überzahlung auch nicht grob fahrlässig übersehen. Grob fahrlässig handelt, wer die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt und nicht beachtet, was jedem hätte einleuchten müssen.
Für Sie bedeutet das: Sie müssen darauf vertraut haben, dass die Gehaltszahlung korrekt war. Wenn die Überzahlung jedoch sehr hoch war oder auf der Gehaltsabrechnung leicht erkennbar gewesen wäre (z.B. eine offensichtlich falsche Eingruppierung oder eine doppelte Auszahlung), könnte Ihnen vorgeworfen werden, dass Sie die Überzahlung hätten erkennen müssen. Im öffentlichen Dienst wird von den Beschäftigten oft erwartet, dass sie ihre Gehaltsabrechnungen prüfen. Waren Sie nicht gutgläubig, müssen Sie das Geld zurückzahlen, auch wenn Sie es ausgegeben haben.
Wer muss was beweisen?
Sie als Arbeitnehmer müssen beweisen, dass Sie entreichert sind. Das heißt, Sie müssen darlegen und im Streitfall beweisen:
- Dass Sie das Geld ausgegeben haben.
- Wofür Sie das Geld ausgegeben haben (um zu zeigen, dass es sich um Luxusausgaben handelte und keine eigenen Aufwendungen erspart wurden).
- Dass Sie gutgläubig waren, also die Überzahlung weder kannten noch grob fahrlässig übersehen haben.
Besonderheiten im öffentlichen Dienst
Im öffentlichen Dienst gelten oft Tarifverträge (wie der TVöD oder TV-L). Diese sehen meist kurze Ausschlussfristen vor (z.B. sechs Monate), innerhalb derer der Arbeitgeber die Überzahlung bemerken und zurückfordern muss (§ 37 TVöD/TV-L). Versäumt der Arbeitgeber diese Frist, kann der Rückforderungsanspruch ausgeschlossen sein, unabhängig davon, ob Sie entreichert sind oder nicht. Allerdings gelten diese Fristen oft nur, wenn Sie selbst die Überzahlung nicht kannten oder grob fahrlässig übersehen haben.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Allein die Tatsache, dass das überzahlte Geld ausgegeben wurde, reicht nicht aus, um die Rückzahlung zu verweigern. Es kommt entscheidend darauf an, ob Sie gutgläubig waren und ob das Geld für Luxusausgaben verwendet wurde, die keinen bleibenden Wert geschaffen oder notwendige Ausgaben ersetzt haben. Die Beweislast hierfür liegt bei Ihnen.
Welche Möglichkeiten der Ratenzahlung oder des Verzichts auf Rückforderung gibt es bei überbezahltem Gehalt im öffentlichen Dienst?
Grundsätzlich muss zu viel gezahltes Gehalt zurückgezahlt werden. Es gibt jedoch Situationen, in denen der Arbeitgeber im öffentlichen Dienst einer Ratenzahlung zustimmen oder unter besonderen Umständen sogar teilweise oder ganz auf die Rückforderung verzichten kann.
Möglichkeit der Ratenzahlung
Eine Ratenzahlung ist die häufigere Möglichkeit, um finanzielle Härten für den Beschäftigten abzumildern. Wenn die sofortige Rückzahlung des gesamten überzahlten Betrags für Sie eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen würde, kann der Arbeitgeber in der Regel einer Stundung und Ratenzahlung zustimmen.
- Voraussetzung: Sie müssen darlegen können, dass Ihnen die sofortige Rückzahlung des vollen Betrags wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Hierzu ist es meist erforderlich, Ihre finanzielle Situation offen zu legen.
- Entscheidung: Die Entscheidung über die Gewährung einer Ratenzahlung liegt in der Regel im Ermessen des Arbeitgebers. Er muss dabei jedoch fair und angemessen handeln und Ihre persönliche Situation berücksichtigen (sogenannte Billigkeitserwägungen). Eine gesetzliche Verpflichtung zur Gewährung von Ratenzahlung besteht meist nicht direkt, ergibt sich aber oft aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers oder spezifischen Regelungen in Tarifverträgen (z.B. TVöD, TV-L) oder Beamtengesetzen.
Möglichkeit des Verzichts auf Rückforderung (Erlass)
Ein teilweiser oder vollständiger Verzicht auf die Rückforderung (auch Erlass genannt) ist deutlich seltener und an strengere Voraussetzungen geknüpft.
- Voraussetzung: Ein Verzicht kommt meist nur in Betracht, wenn die Rückzahlung – selbst in Raten – für Sie eine unzumutbare soziale Härte bedeuten würde. Dies ist mehr als nur eine finanzielle Belastung; es geht darum, dass Ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage gefährdet wäre. Ein weiterer Grund kann sein, wenn der Fehler eindeutig und ausschließlich beim Arbeitgeber lag und Sie keinerlei Anlass hatten, die Überzahlung zu bemerken (dies ist jedoch rechtlich komplex und wird streng geprüft).
- Entscheidung: Auch hier entscheidet der Arbeitgeber nach Ermessen unter Billigkeitsgesichtspunkten. Da öffentliche Gelder betroffen sind, muss der Arbeitgeber die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachten. Ein Verzicht wird daher nur in begründeten Ausnahmefällen gewährt. Die rechtlichen Grundlagen finden sich ebenfalls oft in Tarifverträgen oder gesetzlichen Regelungen (z.B. § 12 Abs. 2 Satz 3 Bundesbesoldungsgesetz für Beamte, oder Regelungen zur Billigkeit in Tarifverträgen), die dem Arbeitgeber ein solches Ermessen einräumen.
Es gibt also keinen automatischen Anspruch auf Ratenzahlung oder Verzicht. Die Entscheidung hängt von den Umständen des Einzelfalls, den geltenden rechtlichen (z.B. Tarifvertrag, Gesetz) und haushaltsrechtlichen Vorgaben sowie der Ermessensentscheidung des Arbeitgebers ab, die jedoch an Fairness und Zumutbarkeit (Billigkeit) gebunden ist.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – Fragen Sie unverbindlich unsere Ersteinschätzung an.

Glossar
Juristische Fachbegriffe kurz erklärt
Prozesskostenhilfe (PKH)
Prozesskostenhilfe ist eine staatliche finanzielle Unterstützung für Personen, die die Kosten eines Gerichtsverfahrens (z. B. Anwalts- und Gerichtskosten) nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Sie wird nur gewährt, wenn die Person finanziell bedürftig ist und ihr rechtliches Anliegen ausreichende Erfolgsaussichten hat (§§ 114 ff. Zivilprozessordnung – ZPO). Im vorliegenden Fall wurde der ehemaligen Mitarbeiterin die PKH für ihre Berufung verweigert, weil das Gericht keine solchen Erfolgsaussichten sah. Die PKH soll einen gleichen Zugang zum Recht für alle Bürger sicherstellen.
Ausreichende Erfolgsaussichten
Dies ist eine zentrale Voraussetzung für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe. Das Gericht prüft dabei vorab, ob die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung des Antragstellers eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, erfolgreich zu sein. Es muss also eine realistische Chance bestehen, den Prozess zumindest teilweise zu gewinnen (§ 114 Abs. 1 S. 1 ZPO). Im Text wurde der ehemaligen Mitarbeiterin die PKH verweigert, da das Landesarbeitsgericht keine solche realistische Chance für den Erfolg ihrer Berufung gegen die Rückzahlungsforderung sah. Die Klage oder das Rechtsmittel darf nicht offensichtlich aussichtslos erscheinen.
Widerklage
Eine Widerklage ist eine Klage, die der Beklagte (die Person, die ursprünglich verklagt wurde) im selben Gerichtsverfahren gegen den Kläger (die Person, die ursprünglich geklagt hat) erhebt (§ 33 ZPO). Anstatt einen separaten Prozess zu beginnen, wird der eigene Anspruch des Beklagten direkt mitverhandelt und entschieden. Im beschriebenen Fall hat die ehemalige Mitarbeiterin (Beklagte) gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber (Kläger) Widerklage auf Erteilung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses mit der Note „gut“ erhoben. Das Gericht entscheidet dann über beide Klagen (ursprüngliche Klage und Widerklage) in einem Urteil.
Ungerechtfertigte Bereicherung (§ 812 BGB)
Dieser Rechtsgrundsatz besagt, dass jemand, der etwas ohne rechtlichen Grund (z. B. ohne gültigen Vertrag oder nach dessen Ende) auf Kosten eines anderen erhalten hat, diesen Vorteil wieder herausgeben muss (§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Im Text war der rechtliche Grund für die Gehaltszahlungen – der Arbeitsvertrag – nach der Kündigung zum 31. August 2022 weggefallen. Die ab September 2023 (laut Urteilstext, wahrscheinlich ein Tippfehler im Text, gemeint ist wohl 2022) erhaltenen Zahlungen erfolgten daher rechtsgrundlos, weshalb die ehemalige Mitarbeiterin zur Rückzahlung verpflichtet ist.
Beispiel: Sie überweisen versehentlich die Miete für einen Monat doppelt an Ihren Vermieter. Da für die zweite Zahlung kein Rechtsgrund (Mietvertrag für diesen Betrag) besteht, hat der Vermieter diesen Betrag ungerechtfertigt erlangt und muss ihn Ihnen nach § 812 BGB zurückzahlen.
Wegfall der Bereicherung / Entreicherung (§ 818 Abs. 3 BGB)
Dies ist ein möglicher Einwand gegen einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (§ 812 BGB). Der Empfänger kann argumentieren, dass er den erhaltenen Vorteil (z. B. das Geld) nicht mehr besitzt, weil er ihn in gutem Glauben verbraucht oder für Dinge ausgegeben hat, die er sich sonst nicht geleistet hätte (z. B. eine Luxusreise), und daher nicht mehr „bereichert“ ist (§ 818 Abs. 3 BGB). Im vorliegenden Fall konnte sich die Mitarbeiterin hierauf jedoch nicht berufen. Der Grund dafür war ihre angenommene Bösgläubigkeit.
Bösgläubigkeit (§ 819 BGB)
Im Kontext der ungerechtfertigten Bereicherung bedeutet Bösgläubigkeit, dass der Empfänger einer Leistung (hier: der Gehaltszahlungen) wusste oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht wusste, dass ihm die Leistung rechtlich nicht zustand (§ 819 Abs. 1 BGB i.V.m. § 818 Abs. 4 BGB). Grob fahrlässig handelt, wer die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße missachtet, also einfachste, naheliegende Überlegungen nicht anstellt. Im Fall der Mitarbeiterin nahm das Gericht an, ihr hätte klar sein müssen, dass nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kein Lohnanspruch mehr besteht. Die Folge der Bösgläubigkeit ist eine verschärfte Haftung: Der Empfänger kann sich insbesondere nicht mehr auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen und muss den Betrag auch dann zurückzahlen, wenn er das Geld bereits ausgegeben hat.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB (ungerechtfertigte Bereicherung): Dieser Paragraph regelt den Anspruch auf Herausgabe von Vermögensvorteilen, die jemand ohne rechtlichen Grund erlangt hat. Es geht darum, ungerechtfertigte Vermögensverschiebungen rückgängig zu machen und eine Ausgleichspflicht herzustellen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Land fordert die Rückzahlung des überzahlten Gehalts auf Grundlage dieser Vorschrift, da die Beklagte die Zahlungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne rechtlichen Grund erhalten hat.
- § 814 BGB (Kenntnis der Nichtschuld): Dieser Paragraph schließt den Bereicherungsanspruch aus, wenn der Leistende wusste, dass er zur Leistung nicht verpflichtet war. Wer eine Zahlung leistet, obwohl er weiß, dass er nicht muss, kann diese in der Regel nicht zurückfordern. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Arbeitsgericht verneinte die Anwendbarkeit von § 814 BGB, da es davon ausging, dass die Beklagte hätte erkennen müssen, dass die Gehaltszahlungen nach der Kündigung irrtümlich erfolgten und sie somit nicht schutzwürdig ist.
- §§ 114 ff. ZPO (Prozesskostenhilfe): Diese Paragraphen regeln die staatliche Unterstützung für bedürftige Personen bei der Finanzierung eines Gerichtsverfahrens. Prozesskostenhilfe soll sicherstellen, dass auch Menschen mit geringem Einkommen ihre Rechte vor Gericht durchsetzen können. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Beklagte hat Prozesskostenhilfe für das Berufungsverfahren beantragt, um die Kosten des Rechtsstreits nicht selbst tragen zu müssen. Die Ablehnung der Prozesskostenhilfe durch das Gericht bedeutet, dass sie die Kosten des Berufungsverfahrens selbst tragen muss.
- TV-L (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder): Der TV-L ist ein Tarifvertrag, der die Arbeitsbedingungen und Vergütung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder regelt. Er enthält Regelungen zu Gehalt, Arbeitszeit, Urlaub und Kündigungsschutz und bildet die Grundlage für das Arbeitsverhältnis der Beklagten. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Der TV-L wird im Urteil erwähnt, da er die Grundlage für das Arbeitsverhältnis der Beklagten und damit auch für ihren ursprünglichen Anspruch auf tarifliche Vergütung darstellte. Die Überzahlung bezieht sich auf das tarifliche Arbeitsentgelt gemäß TV-L.
Hinweise und Tipps
Praxistipps für Arbeitnehmer bei Gehaltszahlungen nach Kündigung
Manchmal läuft nach dem Jobende nicht alles glatt. Plötzlich ist mehr Geld auf dem Konto als erwartet – vom alten Arbeitgeber. Das kann schnell zu Problemen führen und böse Überraschungen nach sich ziehen.
Hinweis: Diese Praxistipps stellen keine Rechtsberatung dar. Sie ersetzen keine individuelle Prüfung durch eine qualifizierte Kanzlei. Jeder Einzelfall kann Besonderheiten aufweisen, die eine abweichende Einschätzung erfordern.
Tipp 1: Unerwartete Zahlungen sofort melden
Erhalten Sie nach Ende Ihres Arbeitsverhältnisses weiterhin Gehalt oder andere Zahlungen, die Ihnen nicht (mehr) zustehen, informieren Sie Ihren ehemaligen Arbeitgeber unverzüglich und nachweisbar (z.B. schriftlich per Einschreiben). Bewahren Sie eine Kopie des Schreibens und den Zustellnachweis auf.
⚠️ ACHTUNG: Wer schweigt und das Geld einfach behält, muss in der Regel alles zurückzahlen. Sich darauf zu berufen, das Geld sei bereits ausgegeben („Wegfall der Bereicherung“), funktioniert meist nicht, wenn Sie wussten oder hätten erkennen müssen, dass die Zahlung falsch war.
Tipp 2: Kontoeingänge und Abrechnungen genau prüfen
Kontrollieren Sie Ihre Kontoauszüge und die letzten Gehaltsabrechnungen auch nach dem offiziellen Ende des Arbeitsverhältnisses sorgfältig. Überprüfen Sie, ob Zahlungen eingehen, die zeitlich oder der Höhe nach nicht mehr mit dem beendeten Vertrag übereinstimmen.
Beispiel: Ihr Vertrag endete zum 31. August, aber Sie erhalten im September und Oktober weiterhin volles Gehalt ohne ersichtlichen Grund (wie z.B. eine Urlaubsabgeltung). Das ist ein klares Warnsignal.
Tipp 3: Überzahlungen nicht ausgeben
Betrachten Sie Geld, das Ihnen nach Vertragsende ohne rechtlichen Grund (z.B. Gehalt für Monate nach Austritt) überwiesen wird, nicht als Ihr Eigentum. Legen Sie es sicherheitshalber zur Seite, bis die Angelegenheit geklärt ist. Sie müssen fest damit rechnen, dass der Arbeitgeber die Summe zurückfordert.
Tipp 4: Arbeitszeugnis separat einfordern
Ihr Anspruch auf ein korrektes, qualifiziertes Arbeitszeugnis besteht unabhängig davon, ob es Streitigkeiten über Gehaltszahlungen gibt. Fordern Sie das Zeugnis schriftlich und unter Setzung einer angemessenen Frist bei Ihrem ehemaligen Arbeitgeber an, falls es Ihnen nicht automatisch ausgestellt wird.
Weitere Fallstricke oder Besonderheiten?
Die Pflicht zur Rückzahlung von zu viel erhaltenem Gehalt ergibt sich aus dem Gesetz (§ 812 Bürgerliches Gesetzbuch – ungerechtfertigte Bereicherung). Der Einwand, das Geld sei nicht mehr vorhanden, weil es bereits ausgegeben wurde (§ 818 Abs. 3 BGB – Entreicherung), greift in der Regel nicht, wenn der Arbeitnehmer wusste oder erkennen musste, dass ihm das Geld nicht zustand (§ 819 BGB). Dies ist bei Gehaltszahlungen nach Vertragsende oft der Fall.
✅ Checkliste: Gehalt nach Kündigung erhalten
- Kontoauszüge nach dem letzten Arbeitstag genau prüfen.
- Unerklärliche Zahlungen identifizieren (Zeitraum? Höhe?).
- Ehemaligen Arbeitgeber umgehend und nachweisbar über die Fehlzahlung informieren.
- Überzahlten Betrag nicht ausgeben, sondern für die Rückzahlung bereithalten.
- Anspruch auf Arbeitszeugnis prüfen und ggf. separat einfordern.
Das vorliegende Urteil
Landesarbeitsgericht Niedersachsen – Az.: 4 SLa 755/24 – Beschluss vom 18.03.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.












